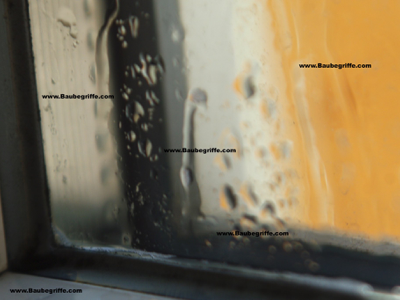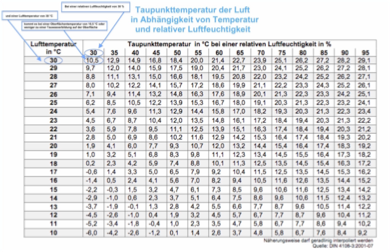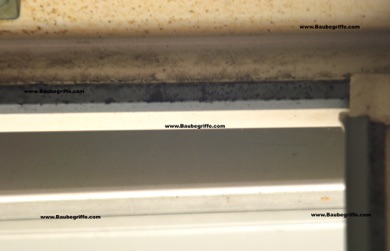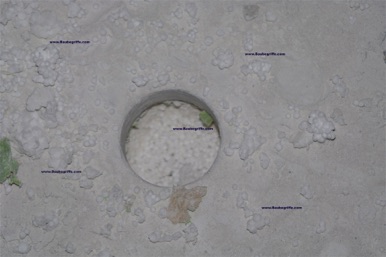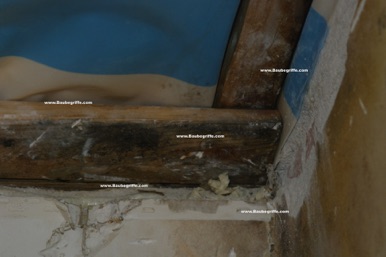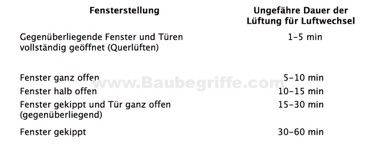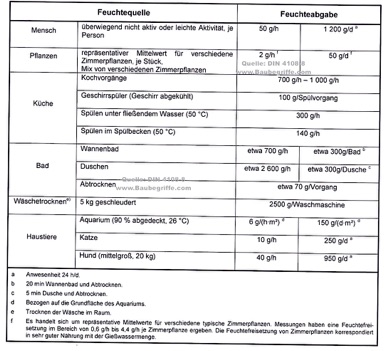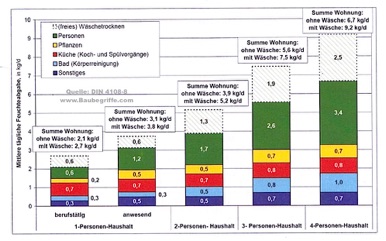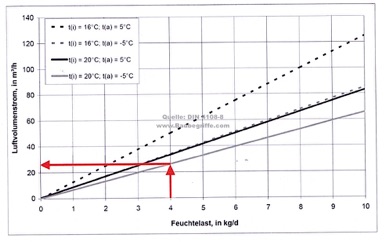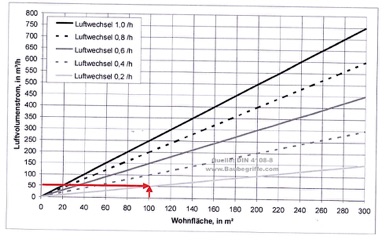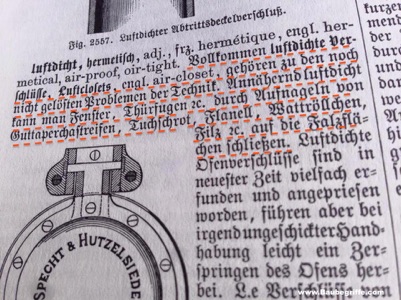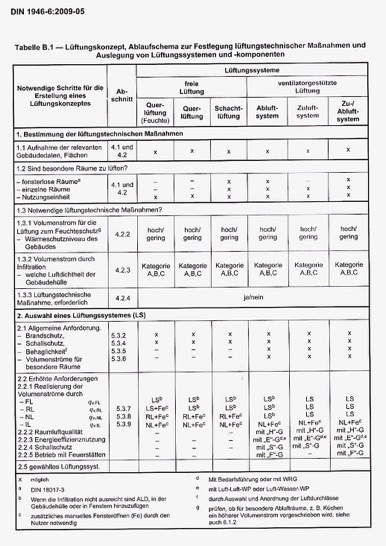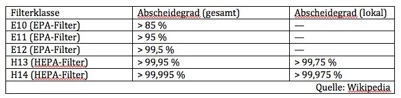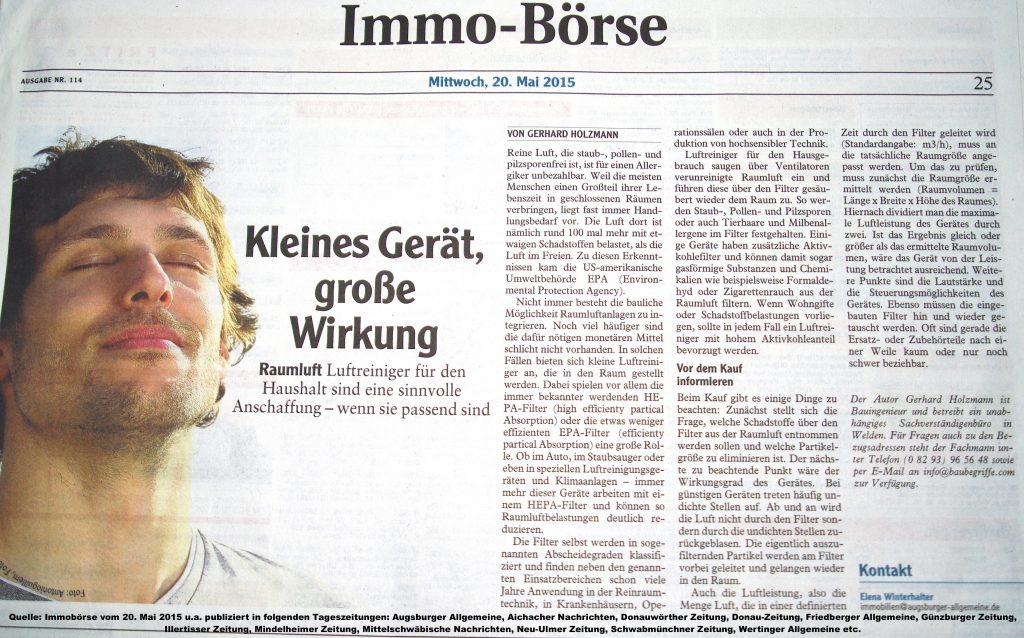Ein brisantes Thema bei Mieter und Vermietern, aber wie nachfolgende Urteilsliste aufzeigt, auch eines, zu welchem man keine Pauschalitäten vorgeben kann. Die einzige, allgemein durchaus gültige Grundregel dabei ist, dass nutzerverschuldete Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung auch dem Nutzer (Mieter) zugeschrieben wird und dafür eine Mietminderung nicht gerechtfertigt ist. Ist die Ursache aber baulich bedingt, so ist der Mieter in aller Regel zu einer Mietminderung berechtigt und der Vermieter zur Nachbesserung (Beseitigung des Baumangels oder des Bauschadens) angehalten. Einzige Ausnahme stellt hierbei wohl die Baufeuchte nach einem Neubaubezug dar.
Einfach mal die Miete kürzen ist einfach falsch
Aber Vorsicht, all zu oft liest man Ratschläge wie „Umgehend die Miete kürzen!“ oder gar „Keine Miete mehr bezahlen!“. So einfach ist das in aller Regel nicht. Kürzen Sie ungerechtfertigt einfach mal den vertraglich vereinbarten Mietzins, kann dies ganz andere Probleme mit sich ziehen. Wichtig für die geplante Mietminderung und der damit juristisch ausgedrückten „Geltungmachung eines Zurückbehaltsrechts wegen Mängel in einer Wohnung“ ist, dass der Vermieter von dem Mangel auch Kenntnis hat. Das heißt der Mieter muss dem Vermieter den Mangel angezeigt haben. In einem Verfahren am Bundesgerichtshof im Jahr 2010 (AZ 8 ZR 330/09) wurde ein Fall verhandelt, zu welchem ein Mieter einfach mal 3 Monate keine Miete bezahlte und zuvor einen Monat nur einen Teil des eigentlichen Mietzinses. Aufgrund des Zahlungsverzuges wurde dem Mieter fristlos gekündigt. Der Mieter widersprach mit dem Hinweis, dass es in mehreren Wohnungen einen Schimmelpilzbefall gäbe. Nach den Gängen des juristischen Verlaufs vom Amtsgericht zum Landesgericht, bis hin zum Bundesgerichtshof, wurde letztlich vom BGH entschieden, dass die fristlose Kündigung und die damit verbundene Forderung zur Räumung und Herausgabe der Wohnung gerechtfertigt war, da der Mieter vor etwaigen Mietminderungen den Vermieter über entsprechenden Schaden hätte informieren müssen. Nur ein Beispiel von vielen, warum die selbstbestimmte Einstellung oder Kürzung der Mietzahlung eher nicht vorteilhaft ist.
Ursache der Schimmelschäden feststellen lassen
Der beste und auch sicherste Weg ist grundsätzlich einen unabhängigen und neutralen Bausachverständigen für Bauschäden und Baumängel zu beauftragen und zunächst die Ursache feststellen zu lassen. Grund hierfür ist, dass in so manch Fällen der Mangel vom Mieter zwar gerügt wird, der Vermieter aber die Angelegenheit ganz anders sieht und es einen Disput darüber gibt, aufgrund wessen Schuld der Schaden eingetreten ist. Oder, und das gibt es auch öfter, der Vermieter entdeckt einen Schaden, den laut dessen Aussage der Mieter verschuldet hat und hierauf folgt ähnlicher Disput wie zuvor aufgezeigt.
Neutralen Sachverständigen mit Kompetenz wählen
Ein seriöser und kompetenter Bausachverständige verfügt über ein komplexes bautechnisches Wissen und sollte, sofern man dessen Gutachten auch für eine gerichtliche Auseinandersetzung nutzen möchte, neutral und unabhängig sein. Führt er selbst ein Saniergewerbe, z.B. zur Schimmelpilzbeseitigung aus, so wird selbiger als nicht neutral gewertet, denn er handelt im Interesse seines Sanierunternehmens und nicht als neutraler Sachverständiger. Sie benötigen aber auch keinen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, deutsche Gerichte müssen den qualifizierten Parteivortrag des privaten Sachverständigen ebenso berücksichtigen, wie den eines von der Kammer bestellten Kollegen. Natürlich muss jedoch die Qualität der gutachterlichen Leistung stimmen. Nur die selbstgewählte Bezeichnung Gutachter oder Sachverständiger ist bei weitem zu wenig. Auch die Art des Stempels eines privaten Gutachters ist im Grunde sekundär, TÜV, Dekra oder etwaige Sachverständigenverbände bilden alle ähnlich aus. Wichtig ist die traditionell erworbene Ausbildung, wie ein Meisterbrief, ein staatlich geprüfter Technikerabschluss, ein Universitäts- oder Fachhochschulabschluss und die berufliche Erfahrung. Das beste Studium nützt wenig, wenn die unabdinglich langjährige Berufserfahrungen nicht vorhanden ist. Natürlich können Sie auch gleich hier im Sachverständigenbüro Holzmann-Bauberatung anrufen (Tel.: 0821 – 60 85 65 40). Mein Sachverständigenbüro ist unabhängig und neutral, was auch grundsätzlich in jedem Gutachten schriftlich bestätigt wird. Als Bauingenieur und Stuckateur bin ich selbstverständlich entsprechend qualifiziert, was auch durch eine Vielzahl von Aufsätzen in diversen Fachblättern bestätigt sein dürfte und natürlich komme ich persönlich zu Ihnen, egal wo Sie wohnen.
Juristische Beratung bei Schimmelschäden einholen
Nachdem die Ursache feststeht, kann mit einem Fachanwalt eine mögliche Mietkürzung oder eben ein relevanter Nachlass des Mietzinses (um möglichen Streitereien zuvorzukommen) besprochen werden. Wie Sie nachfolgend sehen werden, gibt es äußerst unterschiedliche Urteile, die offenbar auch von Region zu Region Differenzen aufzeigen. Ein Fachanwalt wird Sie als Mieter oder auch Vermieter ausführlich hierzu beraten. Das Sachverständigenbüro Holzmann-Bauberatung schlägt seinen Klienten im Bedarfsfall gerne entsprechend erfahrene Juristen vor.
Gerichtsurteile zu Schimmelschäden
Sammlung zu deutschen Rechtsprechungen an unterschiedlichen Gerichten, die zu Mietminderungen bei Feuchtigkeits- oder Schimmelschäden in Mietobjekten geurteilt haben inkl. deren Aktenzeichen und Ergebnisse:
Tropfwasser von der Decke, durchfeuchteter Bodenbelag
AG Münster 28 C 272/80
Mietminderung: 50 %
Wandfeuchtigkeit mit Schimmelpilzbildung
AG Darmstadt 37 C 2894/78
Mietminderung: 10 %
Neubaufeuchtigkeit
LG Hannover 9 S 88/74
Mietminderung: 0 %
Schimmelbefall, der durch das Nutzerverhalten verursacht wurde
AG Schöneberg 102 C 194/13
Mietminderung: 0%
Schimmelpilzwachstum nur durch ständiges Lüften vermeidbar
AG München 412 C 11503/09
Mietminderung: 100 %
Schimmelbefall im Schlafzimmer über den Fußbodenleisten
LG Berlin 65 S 524/13
Mietminderung: 15 %
Schimmelpilzbefall in einem Badezimmer
AG Schöneberg 109 C 256/07
Mietminderung: 10 %
Schimmelbefall
LG Gießen 1 S 199/13
Mietminderung: 15 %
Durch Feuchtigkeit beschädigter Laminat
AG Schöneberg 109 C 256/07
Mietminderung: 10 %
Schimmel hinter einem Kleiderschrank an der Außenwand
LG Lübeck 1 S 106/13
Mietminderung: 15 %
Schimmelpilzwachstum, lärmende Trocknungsgeräte und fehlende Duschmöglichkeit
AG Köln 224 C 100/11
Mietminderung: 80 %
Bei Altbauwohnungen ist mit Feuchtigkeit im Keller zu rechnen
AG Ansbach 2 C 2268/11
Mietminderung: 0 %
Feuchtigkeitserscheinungen bzw. Schimmelpilzwachstum im Schlafzimmer
LG Konstanz 61 S 21/12 A
Mietminderung: 20 %
Mietminderung kommt nach Einbau eines Einbauschrankes nicht zustande
LG Kiel 1 S 102/11
Mietminderung: 0 %
Feuchtigkeit in einem Keller in einem Nachkriegskeller
AG München 461 C 19454/09
Mietminderung: 0 %
Klemmende Fenster in einem Hobbyraum, abblätternde Farbe und Feuchtigkeit
AG Schöneberg 4 C 51/11
Mietminderung: 50 %
Erhöhter Lüft- und Heizbedarf nach dem Einbau neuer Fenster in einen Altbau
AG Nürtingen 42 C 1905/09
Mietminderung: 0 %
Schimmelpilzbefall nach dem Einbau neuer Fenster
AG Gotha 2 C 116/02
Mietminderung: 10 %
Durchnässte Wände in allen Räumen mit zusätzlichem Schimmelpilzwachstum in einem Raum
LG Berlin 64 S 356/98
Mietminderung: 15 %
Nässe im Keller nach Regen
AG Düren 8 C 465/81
Mietminderung: 5 %
Alleiniger Verdacht, dass die Familie ist durch den Schimmelpilz gesundheitlich gefährdet ist
KG Berlin 12 U 164/09
Mietminderung: 0 %
Schimmelpilzwachstum an mehreren Stellen in einer Wohnung
AG Norderstedt 42 C 561/08
Mietminderung: 10 %
Erheblicher Schimmelpilzbefall in mehreren Zimmern
LG Hamburg 307 S 39/09
Mietminderung: 25 %
Schimmelpilzbefall an mehreren Wänden
AG Königs Wusterhausen 9 C 174/06
Mietminderung: 20 %
Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall in mehreren Räumen
LG Berlin 65 S 205/89
Mietminderung: 80 %
Schimmelpilzbefall und Käferplage
AG Trier 8 C 53/08
Mietminderung: 50 %
Erheblicher Schimmelpilzbefall in einem Wohnzimmer
LG Hamburg 307 S 144/07
Mietminderung: 50 %
Feuchtigkeit in einem Erdgeschoß
AG Bad Vibel 3 B C 52/96
Mietminderung: 60 %
Feuchte Wände, Rattenbefall, Schimmelpilzwachstum, Fehlendes Geländer
AG Potsdam 26 C 533/93
Mietminderung: 100 %
Abflussrohr schadhaft und dadurch Feuchtigkeitsschaden an Parkett und Wand
LG Düsseldorf 24 S 242/94
Mietminderung: 25 %
Neubaufeuchte
AG Langen 3 C 293/81
Mietminderung: 0 %
Haben Sie Probleme mit Schimmelpilzbefall oder mit zu hoher Luftfeuchtigkeit im Wohnraum? Dann rufen Sie uns unter Tel.: 0821 – 60 85 65 40 an und vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Wir helfen ihnen gerne als Sachverständige für Baumängel und Bauschäden.