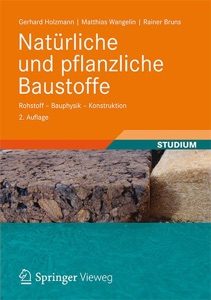Luftpolsterfolien kennt man vor allem in der Verpackungsindustrie, kaum eine Verpackung in welcher die Kunststofffolien mit den eingeschweißten Luftpölsterchen nicht vorhanden ist. In Österreich ist schon vor mehr als 10 Jahren (siehe einen Bericht von mir aus dem Jahr 2001 in „Holzhäuser im Detail“ vom Weka-Baufachverlag) ein findiger Entwickler auf die Idee gekommen hieraus ein Dämmmaterial für das Bauwesen zu entwickeln, die Lu..poTherm B2+8. Dieser bauaufsichtlich zugelassene Dämmstoff, der nicht nur eine hohe Dämmleistung bei geringer Dämmdicke vorweist, sondern hierzu lt. Herstellerangaben auch noch eine hervorragende Abschirmeigenschaft gegenüber elektromagnetische Strahlung zum Vorschein bringt, ist eine weitere Alternative zu den traditionellen Dämmstoffen am Markt. Die Dämmeigenschaft wird aber schon länger genutzt. So gibt es einige Gärtnereibetriebe, die ihre Gewächshäuser im Winter in Luftpolsterfolie packen um Heizkosten sparen zu können.
Im Gegensatz zu den in der Verpackungsindustrie verwendeten Folien (zumeist LD-PE – Low Density Polyethylen) wird die Luftpolsterfolie der Lu..poTherm B2+8 aus HD-PE (High Density Polyethylen) hergestellt und erreicht somit eine drei- bis vierfach höhere Festigkeit. Das eingangs aufgezeigte Bild ist also kein Abbild der Dämmfolie. Ebenso sind die Grundstrukturen der Luftpölsterchen an sich nicht wie üblich kreisrund, sondern in einem bienenwabenähnlichen sechseckigen Grundriss, was ebenso zu einer höheren Festigkeit führt.

Der Materialaufbau der Lu..poTherm B2+8 besteht aus acht Lagen Luftpolsterfolie sowie zwei, jeweils außen angeordneten Lagen gewebeverstärkter und metallisierte Folie. Zur Verstärkung der Infrarotreflektion ergänzen drei weitere metallisierte Polypropylen-Folien im Inneren den Aufbau. Somit besteht die Verbundwärmedämmmatte aus insgesamt 13 Lagen, die umlaufend zu einem kompletten Schichtpaket randverschweißt sind. Die Lagesicherung innerhalb des Mattenaufbaus wird durch sogenannte T-Endfäden gewährleistet, welche alle dreißig cm 12 der 13 Lagen zusammenhält. Die 13. Lage bleibt unperforiert da somit, durch deren hochdichte Metallbeschichtung, die Luftdichtigkeit und die praktische Wasserdampfundurchlässigkeit der Matte gewährleistet wird.
Dieser Materialaufbau ist somit in der Lage alle Arten des Wärmedurchgangs zu minimieren (Transmission, Konvektion und den Strahlungsdurchgang). Speziell bei der Strahlungsdurchgangsprüfung bzw. die Infrarotreflexion an der Wärmedämmung, welche in Ländern wie z.B. Frankreich wesendlich exakter und genauer untersucht wird, erreicht die Luftpolsterdämmung hervorragende Werte. Es konnten hierbei Wärmedurchlasswiderstände von bis zu 5,0 W/m²K nachgewiesen werden, dies entspricht einem U-Wert von ca. 0,2 W/(m²K) – was bei einer nur 3 cm dicken Dämmung ansonsten kaum erreicht wird.
Die Lu..poTherm B2+8 entspricht gemäß bauaufsichtlicher Zulassung der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102. Bei der Herstellung werden in geringen Mengen halogenfreie Flammhemmer eingesetzt, wodurch das Material nicht brennend abtropft oder nachglimmt.
Ein weiterer Vorteil der Lu..poTherm B2+8 ist die Eigenschaft zur Abschirmung elektromagnetischer Strahlung. Durch die sehr dünne metallisierte Folie im Mattenaufbau kann bei einer kompletten Anwendung der Wärmedämmung in Boden, Wand und Dach ein sicherer Schutz in Form eines Faradayschen Käfigs gegen Elektrosmog hergestellt werden. Für den Verarbeiter bedeutet dies dass er seinem Kunden einen Zusatznutzen anbieten kann ohne zusätzliche Arbeitsgänge oder der damit entstehenden Kosten.
Die Ausführung einer Auf- oder Zwischensparrendämmung ist relativ leicht, sehen Sie im Folgendem die Verlegeanleitungen in Stichpunkten:
Aufsparrendämmung

-
Zur Mengenberechnung wird die Länge von Außenkante Giebel zu Außenkante Giebel gemessen und pro Sparren 1 bis 2 cm zugegeben.
-
Die Rollen werden über den Sparren in Firstrichtung ausgerollt und bündig über der Außendämmung unten, rechts und links ausgerichtet und mit Klammern fixiert.
-
Anschließend wird die Konterlattung durch die Folie auf den Sparren angeschraubt (siehe Bild 1), die Lattung sollte von der Mitte nach rechts und links aufgebracht werden um Faltenbildung zu vermeiden.
-
Die Bahnen werden schuppenartig mit einer ca. 5 cm weiten Überlappung zur vorherigen Bahn aufgelegt, bevor auch diese Bahn mit der Konterlattung verschraubt wird.
-
Die Verbindungspunkte an der Fußpfette oder dem Mauerwerk sowie am First (hier ebenso überlappend) muss fest und dicht befestigt werden. Speziell die Mauerwerksanschlüsse müssen winddicht ausgeführt werden.
-
Die Überlappungen sowie alle Durchdringungen werden mit Reinacrylatklebebänder Luft- und Winddicht abgeklebt.
Zwischensparrendämmung

-
Zur Mengenberechnung wird der Abstand zwischen den Sparren gemessen, hierzu werden jeweils zwei Lattenbreiten und zusätzlich 1 bis 6 cm hinzugerechnet, z.B. Sparrenabstand 70 cm + zwei Lattenbreiten à 5 cm + 5 cm = 85 cm pro Feld
-
Mit einer Schere oder einem Messer werden nun die in der Beispielrechnung genannten 85 cm abgetrennt und hochkant zwischen den Sparren recht und links mit Klammern fixiert (von unten nach oben oder umgekehrt).
-
Auch hier werden wie bei der Aufsparrendämmung die Lagen untereinander ca. 5 cm überlappt.
-
Anschließend werden die Folien mit Hilfe der Lattung rechts und links, durch die Folie in die Sparren verschraubt, gleiches gilt für Fuß- und Firstpfette.
-
Die Überlappungen sowie alle Durchdringungen werden auch hier mit Reinacrylatklebebänder Luft- und Winddicht abgeklebt.
-
Ebenso müssen auch hier die Mauerwerksanschlüsse winddicht ausgeführt werden.

Dieser Text stammt aus dem Jahr 2001 und wurde zu jener Zeit in Teilen beim WEKA Fachverlag im Werk „Holzhäuser im Detail“ publiziert. Angaben können vom aktuellen Stand abweichen.