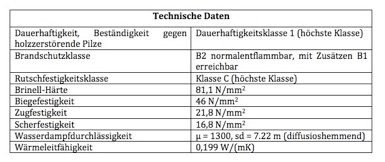Haben Sie sich auch schon einmal gedacht, dass die Keramik- oder Glasfliesen im Badezimmer, schön aber irgendwie auch immer kalt sind? Dann habe ich nun die passende natürliche Alternative. Eine Alternative, die nicht nur warm aussieht, sondern auch ein warmes Gefühl beim begehen vermittelt. Die Holzfliese. Richtig gelesen, Fliesen aus Holz und das auch noch in Mosaikoptik.
Sie können solch Holzfliesen in insgesamt 13 unterschiedlichen Holzarten beziehen, als da wären beispielsweise Ahorn-, Kirschbaum-, Nussbaum-, Wengen-, Doussié-, Iroko-, Teak- oder auch Eichenholz. Das Verlegemuster wird, wie auch bei gewöhnlichen Mosaikfliesen durch die gewählte Größe der einzelnen Holzfliesen bestimmt. Der Hersteller bietet hiezu 4 unterschiedliche Formate an, die alle mit den gängigen Mosaikfliesenformaten übereinstimmen. Zur schnellen und einfacheren Verlegung sind die Holzfliesen auf einem Glasfasergewebe mit einer Maschenweite von 4 x 4 mm als Trägermaterial fixiert, identisch wie bei Keramik- oder Glasmosaik. So haben Sie vorgefertigte Mosaikfliesen, die dann mit einem Maß von 288 x 288 mm schnell und vor allem auch einfach verlegbar sind.
Die handverlesene Sortierung nach Holzqualitäten garantiert bei diesem Produkt einen harmonischen Anblick der fertig belegten Flächen ohne etwaige Holzfehler. Wird das Holzmosaik fachgerecht verlegt, so erhalten Sie, dank einer einheitlichen Kalibrierung der einzelnen Elemente am Ende eine exakte Linienführung im Mosaik und im gesamten Fugenbild, sowohl horizontal, als auch vertikal.
Das Verkleben der Fliesen erfolgt, wie auch das Verfugen mit einem speziell hierfür entwickeltem Klebe- und Fugenmaterial. Sie werden alleine vom Verlegemuster somit keine Unterschiede zu den gewöhnlichen Baumarktfliesen ersehen können. Das Verlegen selbst ist von jedem Fliesenleger durchführbar, da sich die Arbeitsschritte nicht von denen der gewohnten Fliesen unterscheiden. Auch hier wird der Kleber mit einer normalen Zahnspachtel für Dünnbettkleber (Zahnung 3 x 3 mm) auf den verlegereifen und ebenen Untergrund aufgebracht. Unterschiede gibt es aber beim Schneiden, denn Sie benötigen keinen Fliesenschneider, sondern eine kleine Handkreissäge. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Holzfliesen mind. 2 Tage vor der Verlegung im zu verlegenden Raum oder einem, diesem Raumklima gleichenden Umfeld liegen sollten. Ein Muss, das beispielsweise auch bei Parketten Usus ist. Sind die Fliesen verklebt und der Kleber trocken, erfolgt das Füllen der Fugen, auch hier identisch zu den Alltagsfliesen, mit dem Gummifugbrett. Für das Reinigen der verfugten Oberflächen wird dann, je nach Produktlinie, ein entsprechender Schwamm und klares Wasser benötigt.
Die Oberflächen des Holzmosaiks sind in aller Regel UV-sicher, mehrfach geölt, versiegelt und somit auch alkalibeständig. Eine tolle Sache, denn damit kann dieses Holzmosaik nicht nur in Wohnräumen, sondern auch in Feuchträumen, wie beispielsweise dem Badezimmer an Wand, Boden und Decke aufgebracht werden. Für direkte Naßzellen, wie beispielsweise eine Dusche, wird das Holz des Mosaiks in Harz getränkt, wodurch das Quell- und Schwindverhalten sehr stark verringert wird. Spezielle Ausführungen werden künftig sogar eine Nutzung in einer Sauna, einer Badewanne oder gar im Swimmingpool, zulassen. Aktuell gibt es auch eine Variante für den Leichtbau. Hierbei wurde die Stärke der Fliesen auf 2 mm reduziert, wodurch laut Herstellerangaben eine Gewichtsersparnis gegenüber Keramikfliesen von bis zu 95 % erreicht wird. Der Hersteller gibt hierzu auch ein Beispiel: Keramische Fliesen dieser Art haben ein Flächengewicht von ca. 22,5 bis 25 kg/m2, das Holzmosaik in der leichten Variante aber nur ca. 1,05 kg/m2. Ein Aspekt der mitunter bei Altbausanierungen einen bedeutenden Vorteil mit sich ziehen kann, da gerade hier sehr oft auf die einzubringenden Lasten geachtet werden muss.
Was die Wohngesundheit betrifft, so entspricht das Produkt der Formaldehydklasse E1, was im Groben soviel heißt als ,dass das Material unter den im Labor festgelegten Prüfbedingungen, nicht mehr als 0,1 ppm (parts per million zu deutsch: „ 0,1 Teile von einer Million“) Formaldehyd an die Raumluft abgibt. Neben diesem ist aus den Herstellerangaben zu entnehmen, dass das Produkt die DIBt-Zulassung für Innenraumbaustoffe und auch die Anforderungen des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erfüllt.
Wichtig für den Haushalt dürfte vor allem auch die laufende Reinigung und Pflege des geölten Holzmosaiks sein. Allgemein genügt zur Pflege ein Mop, Besen, Staubsauger oder auch ein sogenannter Elektro-Bohnerbesen. Die normale Bodenfläche kann selbstverständlich feucht gewischt werden. Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt der Hersteller spezielle aber dennoch handelsübliche Pflegemittel. Auch hier vergleiche ich gerne mit den alltäglichen Fliesen, denn zum Holzparkett gibt es, wie auch bei Parketten, eine sehr leicht verständliche Pflegeanleitung, was zu Glas- oder Keramikfliesen eher nicht zugereicht wird.
Sollten Sie noch Fragen haben, so können Sie mich gerne im Sachverständigenbüro Holzmann-Bauberatung® kontaktieren (Tel.: 0821 – 60 85 65 40).